
Wenn wir mit der MPU konfrontiert werden, ist selten nur der Führerschein das Thema. Klar, am Anfang schon. Aber dann legt sich nach einigen Tagen der Schock. Und dann geht es um Selbstbild, Kontrolle, Scham und die Frage: „Bin ich eigentlich so, wie ich glaube, dass ich es bin oder sein will?“ Gleichzeitig schwingt ein hartnäckiger Satz im Hintergrund mit: Man hört, dass so viele durchfallen. Dieser Satz ist wie ein kleiner Stein im Schuh – er ist immer da, drückt leise und macht jeden Schritt zur Qual.
MPU-Mythen. Warum ist das häufig so?
Die MPU erscheint vielen als eine Art Blackbox. Man weiß, was man so hört. Dass es um ein Gespräch mit einem Psychologen geht, dazu komische Tests usw.. Was aber davon – heute oft gesagt – Fake-News sind und was der Realität entspricht, bleibt – ungeklärt. So entstanden und entstehen MPU-Mythen.
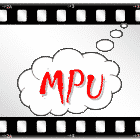
Sie sei willkürlich, es sei Glückssache, man müsse nur „gut reden“ können oder „gute Verbindungen“ haben. Habe ich tatsächlich auch schon gehört. Allerdings war ich zu der Zeit noch als Gutachter tätig. Erstaunlich, wie lang und wie hartnäckig sich manche Annahmen behaupten.
Mein Spitzenreiter ist schon seit Jahren: „Beim ersten Mal fällt man eh immer durch.“ Ich sage dazu jetzt mal – nix.
MPU – ein Missverständnis ?
Ein zentrales Missverständnis besteht v.a. darin, dass sich viele Betroffene komplett auf den Vorfall konzentrieren. Sie denken z.B: „Ich bin einmal zu schnell gefahren“, „Ich hatte zu viel Alkohol“, „Ich habe in diesem Moment falsch reagiert“. In ihrer Vorbereitung werden dann Abläufe rekonstruiert, Uhrzeiten, Wegstrecken, Promillewerte, äußere Umstände. Es wird angenommen, dies sei genau das, was die Gutachter hören wollen. Stimmt zwar – allerdings ist etwas anderes viel wesentlicher:
Die MPU stellt aber eine andere Frage: Es geht um die „charakterliche“ Eignung im weitesten Sinne. Was in Ihrem Denken, Fühlen und Handeln hat diese deliktische Situation möglich gemacht?
Das klingt vielleicht etwas abstrakt, ist aber der Kern. Eine Alkoholfahrt, ein Punktesystem, ein Rotlichtverstoß, eine Unfallflucht – all das ist nicht nur ein Ereignis, sondern Ausdruck einer inneren Logik. Vielleicht war es die Überzeugung „Ich hab‘ das im Griff“, obwohl die Fakten dagegensprachen. Vielleicht war es das Gefühl „Ich muss funktionieren, koste es, was es wolle“. Oft kommt „Schema F“ zum Tragen: „Konsequenzen blende ich lieber aus, bis es nicht mehr geht“.
Wer nur vom Delikt erzählt, erzählt nicht, was das Ganze mit ihm zu tun hat. Und genau daran scheitern viele. Sie bleiben auf der Ebene der äußeren Geschichte und wundern sich, dass der Gutachter am Ende nicht überzeugt ist. Aus deren Sicht ist das nachvollziehbar: Wenn die innere Logik nicht sichtbar wird, lässt sich schwer einschätzen, ob sich wirklich etwas verändert hat.

Und dann gibt es da oft die Widersprüche, die keiner beabsichtigt – aber in der Begutachtungssituation sehr problematisch werden können. Ich möchte niemandem zu nahetreten. Ja, viele, erleben sich selbst als ehrlich. Sie haben das Gefühl, nichts zu erfinden. Sie schildern die Dinge so, wie sie sie erinnern. Und trotzdem entstehen im Gespräch oft Widersprüche. Die Gutachter bemerkten das. Diese Widersprüche sind selten bewusste Lügen. Häufig entstehen sie aus zwei „Kräften“, die gleichzeitig wirken: dem Wunsch, aufrichtig zu sein, und dem Bedürfnis, sich selbst nicht vollständig infrage stellen zu müssen. Wir Psychologen sagen dazu auch „kognitive Dissonanz“. Ein Begriff, den man auch gern mal nachschlagen kann, da er unser Alltagsbegleiter ist.
Ein Beispiel?
Jemand sagt, er sei immer ein vorsichtiger Fahrer gewesen, einfach jemand, der es ernst meint mit Regeln. Im gleichen Gespräch wird deutlich, dass über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu schnell gefahren wurde, das Handy am Steuer „natürlich nur kurz“ benutzt wurde und rote Ampeln eher als Empfehlung wahrgenommen wurden, wenn es eilig sein musste. Keine dramatischen Extremhandlungen vielleicht, aber genug, um ein Muster zu erkennen. Von innen fühlt sich das oft nicht widersprüchlich an. Man sieht sich selbst als „eigentlich vernünftig“ und die Verstöße als Ausnahmen. Von außen entsteht jedoch das Bild eines Menschen, der sein Selbstbild nicht mit den eigenen Handlungen abgleicht. Genau an diesem Punkt beginnt Misstrauen – nicht, weil der Gutachter etwas Böses unterstellt, sondern weil die Geschichte in sich nicht stimmig ist.
Manch einer fällt dann durch, ohne genau sagen zu können warum. Sie haben das Gefühl: „Ich war doch ehrlich.“ Ich habe das schon so oft von Menschen gehört, die sich dann verzweifelt bei mir Hilfe suchten. Und oft stimmt das sogar – im Rahmen dessen, was sie sich gerade zutrauen, auszuhalten. Doch die Ehrlichkeit reicht nicht tief genug. Es fehlen die Teile, in denen man sich selbst in einem etwas weniger schmeichelhaften Licht betrachtet. Auch – wenn es wehtut.
Nur der Ergänzung halber: Es gibt noch andere Widersprüche, die einem bei der MPU zum Verhängnis werden können. Dies sind v.a. Unstimmigkeiten des Gesagten mit der Aktenlage (daher ist die Akteneinsicht so wichtig!) oder mit wissenschaftlichen Erkenntnissen (z.B. Promilleberechnung passt nicht zur angegebenen Trinkmenge – der Klassiker).
Widersprüche – kognitive Dissonanz
Was tun wir also typischerweise, um dem unangenehmen Gefühl der kognitiven Dissonanz zu entrinnen?
Wir gehen v.a. den Weg des geringsten Widerstands: Dazu gehören Verharmlosungen, Umdeutungen, Überbetonung von Pech oder äußeren Umständen. Das passiert, weil es erst einmal erträglicher ist, wenn die Schuld nicht zu nah an das eigene Selbstbild heranrückt:
- „Ich hatte einen schlechten Tag.“
- „Die Polizei war besonders streng.“
- „Das war wirklich ein blöder Zufall.“
- „Eigentlich bin ich nicht so.“
Solche Sätze müssen nicht falsch sein – aber sie verschieben den Fokus. Statt zu fragen „Wie habe ich mich über längere Zeit verhalten?“ wird gefragt „Wie unglücklich war dieser eine Moment?“ Die MPU interessiert sich jedoch kaum für die Pechkomponente. Sie interessiert sich für wiederkehrende Muster.
Wer an diesem Punkt innerlich stehen bleibt, kommt mit Erklärungen, die logisch klingen, aber emotional hohl bleiben. Der Gutachter merkt: Hier spricht jemand, der sein Verhalten aus der Distanz betrachtet, aber nicht aus innerer Beteiligung. Das führt dann zu dem Eindruck, dass etwas nicht „durchgearbeitet“ ist – und genau das ist ein häufiger Grund, warum ein Gutachten negativ ausfällt.
Was also tun? Veränderung!

Wir müssen etwas verändern. Meist nach Innen (z.B. das Erkennen von Verharmlosung), manchmal zusätzlich auch nach außen (z.B. neuer Freundeskreis).
Veränderung braucht mehr als gute Vorsätze.
Fast jeder, der zur MPU kommt, sagt auf die eine oder andere Weise: „So etwas passiert mir nie wieder.“ Dieser Satz ist aufrichtig. Kaum jemand möchte bewusst noch einmal in eine solche Situation geraten. Aber der Wille allein reicht nicht. Echte Veränderung hat Konturen. Sie lässt sich nicht nur beschwören, sie lässt sich zeigen. Sie spiegelt sich in neuen Gewohnheiten, in neuen Entscheidungen und in Momenten, in denen man anders reagiert als früher. Oft nicht nur im Verkehr, sondern auch in anderen Lebensbereichen.
Für Gutachter wird es dann spannend, wenn jemand konkret erzählen kann, wie der Alltag heute anders funktioniert. Wenn jemand zum Beispiel sagt, dass er gelernt hat, Termine so zu planen, dass „schnell noch dahinrasen“ nicht mehr nötig ist. Oder dass Wochenenden, an denen früher regelmäßig viel Alkohol floss, heute anders gestaltet werden – nicht aus Zwang, sondern weil man sich mit sich selbst und seinen Grenzen auseinandergesetzt hat. Oder dass man sich Hilfe gesucht hat, weil man gemerkt hat: Allein dreh‘ ich mich nur im Kreis.
Übrigens scheitern manche nicht, weil sie gar nichts verändert hätten. Sie scheitern, weil sie das, was sie verändert haben, nicht in Worte fassen können. Sie erleben ihre Entwicklung diffus und können sie nicht so greifbar beschreiben, dass Außenstehende daraus ein klares Bild gewinnen. Für die MPU gilt jedoch: Was nicht klar benannt werden kann, wirkt schnell, als sei es nicht vorhanden.
Eine MPU findet in einem Büro statt, in ruhiger Umgebung, fernab von Stau, anderen Verkehrsteilnehmern (die einen nerven könnten) oder einem Feierabendbier mit dem Stammtisch. Das macht es „unverfänglicher“, über sich in idealisierten Szenarien zu sprechen. Man kann sagen, wie man gerne wäre – bedacht, ruhig, verantwortungsvoll. Doch die entscheidende Frage lautet: Wie sieht der Alltag aus, wenn niemand zuhört?
Viele Betroffene trennen in ihrer Darstellung den Vorfall stark vom restlichen Leben. Sie geben das Bild einer im Grunde stabilen Persönlichkeit und irgendwo dazwischen ein plötzliches Verhalten, das „eigentlich gar nicht zu einem passt“. Für das eigene Gefühl ist das eine Entlastung. Es bedeutet: Ich bin nicht grundsätzlich so. Von außen betrachtet wirkt es allerdings unvollständig.
Die meisten riskanten Entscheidungen wachsen aus einem Boden, der aus Stress, Anspannung, ungelösten Konflikten oder festgefahrenen Gewohnheiten besteht. Vielleicht gab es seit längerem das Gefühl, ständig unter Druck zu stehen. Vielleicht war da eine Tendenz, sich selbst immer als „der Belastbare“ zu sehen, der schon alles irgendwie schafft. Vielleicht gab es Alkohol oder andere Substanzen als Mittel, um Abstand vom Alltag zu gewinnen. Vielleicht war da das tiefe Bedürfnis nach Kontrolle – und gleichzeitig die Tendenz, Grenzen zu ignorieren, wenn sie im Weg standen.
Wenn diese Hintergründe in der MPU keine Rolle spielen, bleibt der Vorfall wie ein isoliertes Einzelereignis zurück. Und isolierte Einzelereignisse sind schwer zu beeinflussen. Erst wenn jemand erkennt: „Mein Verhalten im Verkehr passt zu manchen Mustern, die ich auch in anderen Bereichen habe“, entsteht ein Ansatzpunkt für wirkliche Veränderung.
Von der Versuchung, besonders gut wirken zu wollen
Es ist völlig nachvollziehbar, in der MPU einen guten Eindruck machen zu wollen. Man sitzt einer Person gegenüber, die ein Gutachten über einen schreibt, von dem viel abhängt. Man möchte zeigen, dass man vernünftig, reflektiert, verantwortungsbewusst ist. Niemand stellt sich gern offen hin und sagt: „Ich habe lange ziemlich viel verdrängt.“
Der Knackpunkt. Je größer der innere Druck ist, möglichst positiv rüberzukommen, desto mehr gleitet das Gespräch in eine Art „Bewerbungssituation“. Es wird dann nicht mehr von innen nach außen gesprochen, sondern von außen nach innen: „Wie komme ich an?“, „War das die richtige Antwort?“, „Klingt das jetzt gut genug?“
Wir verlieren in solchen Momenten den Kontakt zu uns selbst. Wir orientieren uns mehr daran, was wir glauben, was man von uns hören möchte, als daran, was wirklich da ist. Gutachter spüren das. Die Aussagen werden auf Hochglanz poliert, sind aber nicht wahrhaftig. Es fehlt eine gewisse Tiefe, ein Inneres, das sich zeigt.
Wie geht es besser?
Menschen, die bestehen, wirken oft erstaunlich unaufgeregt in ihrer Selbstbeschreibung. Sie erzählen nicht, wie vorbildlich sie sind. Sie erzählen, wo sie sich verschätzt haben. V.a., wo sie sich selbst etwas vorgemacht haben. Wo sie mehr an ihr „Ich kriege das schon hin“ als an Fakten geglaubt haben. Sie versuchen nicht, ein beeindruckendes Bild abzugeben. Sie zeigen ein echtes.
Das bedeutet nicht, dass man sich klein machen muss. Es bedeutet, dass Selbstbewusstsein etwas anderes ist als Verteidigung. Echtes Selbstbewusstsein hält es aus, die eigenen Fehler klar zu benennen, ohne sich als Mensch zu entwerten.
Was Menschen stark macht, die die MPU bestehen
Wenn man Geschichten von Betroffenen hört, die die MPU geschafft haben, zeigt sich ein Muster: Sie haben irgendwann aufgehört, gegen das System zu kämpfen, und angefangen, mit sich selbst zu arbeiten. Die Frage verschiebt sich von „Wie komme ich da durch?“ zu „Was muss ich wirklich verstehen, damit sich etwas ändert?“ Ein Aspekt, auf den ich in meiner Beratung auch immer wieder hinweise, weil er so wichtig ist.
Sie beschreiben im Nachhinein oft, dass die Vorbereitung auf die MPU mehr gebracht hat als nur die Wiedererteilung der Fahrerlaubnis (meine Klienten erkennen schnell: meine Worte 🫣). Sie haben gelernt, ihre Grenzen besser zu erkennen, mit Stress anders umzugehen, Verantwortung nicht nur nach außen zu tragen, sondern sich selbst gegenüber zu zeigen. Manche merken, dass sie z.B. über ihren Konsum nachdenken mussten. Andere stellen fest, dass sie ihre Lebensführung insgesamt verändern wollen, weil der Vorfall nur die Spitze eines Eisbergs war.
Im MPU-Gespräch wirken diese Menschen weder perfekt noch einstudiert. Sie erzählen auch von Rückschlägen und von Momenten, in denen es schwer war, alte Gewohnheiten loszulassen.
Aber genau das macht sie glaubwürdig. Zu echten Veränderungen gehören Spannungen, Zweifel, manchmal auch schmerzhafte Einsichten. Wenn jemand davon erzählen kann, ohne dabei innerlich zu flüchten, ist das ein starkes Signal.

Ein anderer Blick auf das Durchfallen
Es ist verständlich, das Scheitern bei der MPU als Niederlage zu erleben. Man hat Geld investiert, Zeit, Energie, Hoffnung. Ein negatives Gutachten fühlt sich schnell an wie ein Urteil über die eigene Person: „Ich bin durchgefallen, also stimmt grundsätzlich etwas nicht mit mir.“
In der Praxis ist es oft eher ein Hinweis, dass der innere Prozess einfach noch nicht fertig ist. Manche Themen brauchen mehr Zeit, manche Abwehrmechanismen sind hartnäckiger, als man denkt. Manchmal braucht es auch jemanden von außen, der hilft, die entscheidenden Punkte überhaupt erst sichtbar zu machen.
Wer das Durchfallen als Hinweis, als Information, versteht und nicht als Stempel, den man aufgedrückt bekommen hat, nimmt sich selbst den Druck. Dann kann man fragen: Was habe ich vielleicht noch nicht verstanden? Wo habe ich mich selbst zu sehr geschont? Welche Bereiche meines Lebens habe ich bisher ausgeklammert, die aber eindeutig mit meinem Verhalten zusammenhängen?
In dem Moment, in dem aus „Ich bin durchgefallen“ ein „Ich habe noch nicht alles erkannt“ wird, verschiebt sich etwas Wichtiges. Es geht nicht mehr darum, zu bestehen um jeden Preis, sondern darum, innerlich tatsächlich an den Punkt zu kommen, an dem eine positive Prognose auch realistisch ist.
Am Ende entscheidet die MPU nicht, ob jemand ein „guter“ oder „schlechter“ Mensch ist. Sie entscheidet, ob das Risiko für ein ähnliches Verhalten künftig als vertretbar eingeschätzt wird. Etwas formaler klingt es in der Fragestellung der Führerscheinstelle. Ein nüchterner Satz, aber dahinter steckt eine Chance.
Wer bereit ist, die MPU nicht als Strafe zu sehen, bekommt die Möglichkeit, sich selbst auf eine Weise kennenzulernen, die vorher vielleicht nie nötig war. Das ist unbequem, manchmal schmerzhaft – aber auch eine enorme Entwicklungschance.
On the way
Viele fallen durch, weil sie noch auf dem Weg sind. Und genau daran kann man arbeiten.
Wenn sich also dieser grundsätzliche Blick auf die MPU ändert, verliert sie ein Stück ihres Schreckens. Sie bleibt eine ernste Angelegenheit, aber sie wird zu etwas, worauf man Einfluss nehmen kann. Und genau dort beginnt der Teil, an dem professionelle Begleitung wirklich sinnvoll wird: nicht als „Trickkiste für richtige Antworten“, sondern als Unterstützung dabei, dass die innere Entwicklung echt wird – und nicht nur für den Tag des Gutachtens gehalten ist.
Sorry – ich denke, der Artikel ist länger geworden, als ich das zuvor geplant hatte. Aber ich hoffe, er hilft dem ein oder anderen.
Machen Sie es besser.
Und jetzt etwas ganz anderes. Ich lade Sie ein. Hören Sie mich – in meinem Podcast „MPU KLARTEXT“
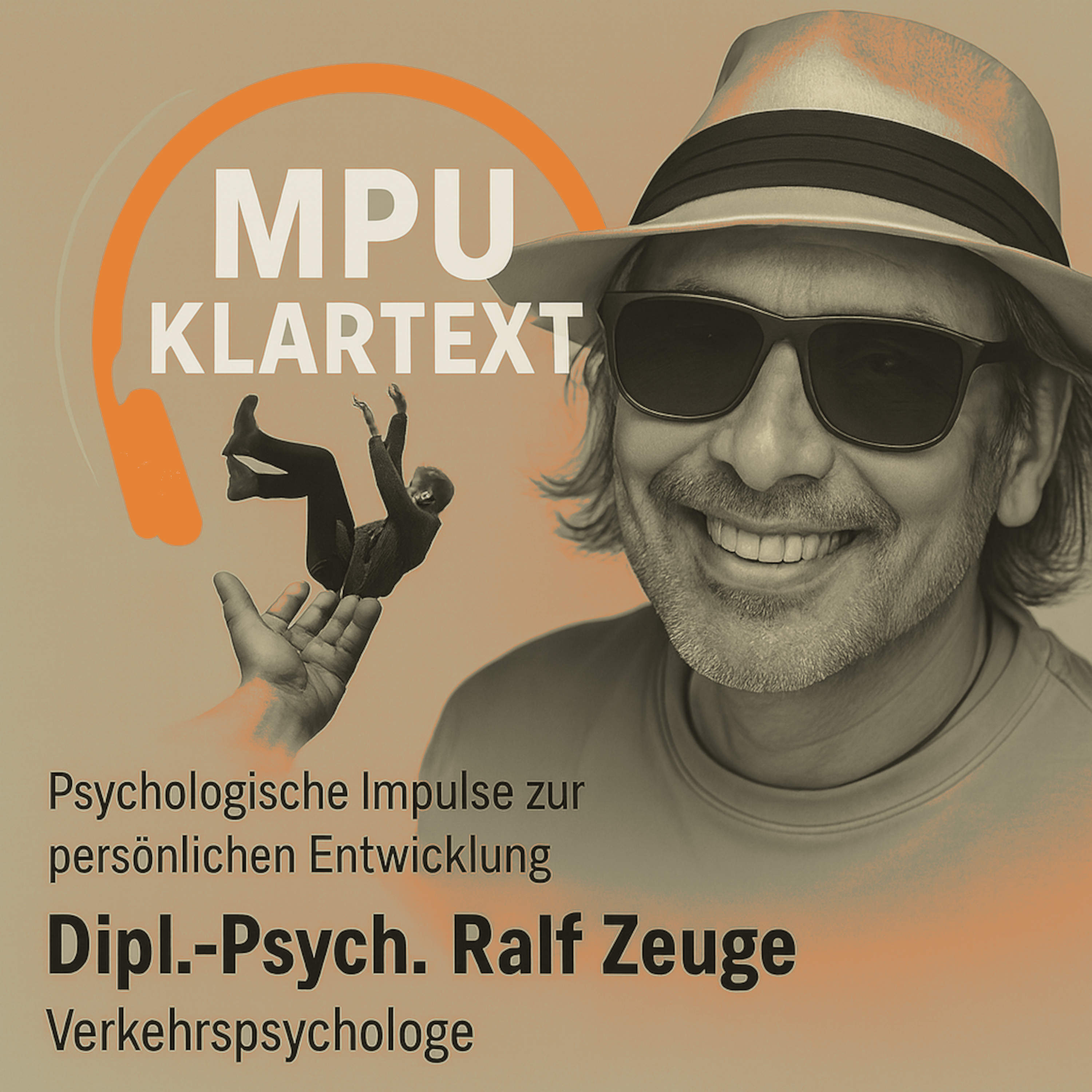
Stellen Sie sich vor: Sie steigen in den Bus, die Bahn oder was auch immer, die Episode läuft – und plötzlich fällt Ihnen auf, wie sehr Sie sich selbst anders wahrnehmen. Nicht nur als „Täter“. Sondern als Mensch, der verstanden wird.
Das ist kein Versprechen auf sofortige Lösung. Aber es ist das Versprechen:
Sie werden anders fühlen. klarer denken. bewusster handeln.
Hören Sie mich. Abonnieren Sie „MPU Klartext – Der psychologische U-Turn“.
Aktuelle Folge:




